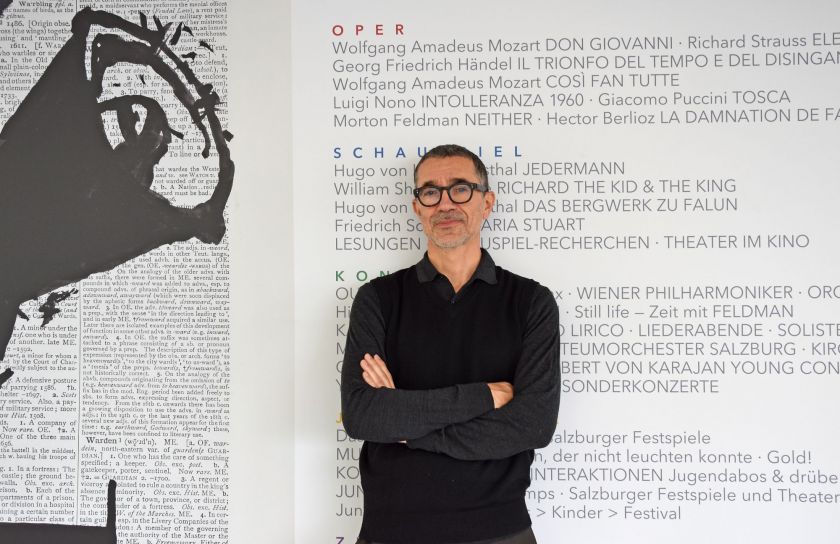
Auch der szenische Doppelabend mit Herzog Blaubarts Burg von Béla Bartók und De temporum fine comoedia von Carl Orff (Premiere 26. Juli) knüpft an die Ouverture spirituelle an. Carl Orffs Oratorienoper, die Regisseur Romeo Castellucci und der musikalische Leiter Teodor Currentzis auf die Festspielbühne bringen, stellt die Frage nach dem Ende von Zeit und Welt, nach dem Guten und Bösen in der Welt und dem göttlichen Gericht darüber. Orffs Werk überwältigt durch seine urtümliche Energie, beharrlich wiederholte rhythmische Muster und ein mechanisches Bewegungsprinzip, das eine Vielzahl von Personen erfasst.
Die Atmosphäre, die Herzog Blaubarts Burg durchdringt, ist dem diametral entgegengesetzt: 1911 auf einen Text von Béla Balázs komponiert, erzählt das Werk von einem Frauenmörder, der seiner von Neugier getriebenen jüngsten Gemahlin Judith verbietet, eine Tür zu öffnen, hinter der er ihre getöteten Vorgängerinnen versteckt hat. Bartóks Oper entwickelt sich ganz aus dem Dialog zwischen den beiden Protagonisten, Blaubart und Judith, und offenbart eine Auffassung des Dramas als eine Art geistiges und emotionales Kraftfeld. Die Konzentriertheit der Handlung, das Fehlen räumlich-zeitlicher Koordinaten und die unergründliche Atmosphäre verweisen auf eine Reise, die sich ganz im Inneren vollzieht.
Das Nebeneinander der beiden Werke offenbart tiefe Verbindungen, und es scheint, als würde das Weltgericht Judith gelten, als hätte sie selbst ein Verbrechen begangen …
